Wie alles begann
Ich war ein lebendiger, verträumter Junge – voller Phantasie, Spiel und Sehnsucht nach Liebe.
Doch von Anfang an schien mein Lebenslicht unterdrückt. Mein Vater lehnte mich ab, demütigte mich. Meine Mutter war überfordert, verletzte mich und klammerte gleichzeitig. Ich war sehr früh allein, innerlich verloren. Mit etwa 8 Jahren sagte ich einmal: „Ich bin eine lebendige Leiche.“ Ich glaube, das war der Moment, in dem ich innerlich starb.
Alles, was danach kam – Schule, Studium, Beruf, Ehe – war über diesen Bruch hinweggebaut. Mein Leben fühlte sich zunehmend fremd und sinnlos an, obwohl ich gleichzeitig immer wieder träumte, kämpfte und hoffte. Ich suchte Liebe und Anerkennung in der Leistung – und verlor mich darin fast vollständig.


Das Trauma nimmt Fahrt auf
Ich wurde sehr gut in der Schule, in der Uni, im Beruf. Ich arbeitete, kämpfte, studierte und wurde sehr erfolgreich. Doch innerlich war ich wie eine Maschine.
Ich wusste: Ich funktioniere, aber ich lebe nicht. In der Ehe, die ich später einging, fand ich keine Rettung, sondern einen Spiegel meines inneren Traumas. Ich war brav, angepasst, stets bemüht. Ich wollte es „richtig“ machen, wurde aber seelisch immer kränker. Nach außen schien alles in Ordnung, doch innen war ich leer.
Ich spürte: So geht das nicht weiter. Ich begann, um mein inneres Kind zu weinen. Alles, was ich an Stärke hatte, richtete ich nun nach innen, auf meine eigene Heilung. Und Jesus war plötzlich da. Ganz sanft, ganz klar. Das war der Anfang meiner Rückkehr zu mir selbst.


Das System bricht zusammen
Ich hielt noch einige Jahre durch, dann brach ich zusammen. Klinik, Medikamente, nichts ging mehr. Ich war am Ende. Gleichzeitig begann meine Heilung. In der Klinik lernte ich, zum ersten Mal wirklich auf mich zu hören. Ich erkannte, wie tief meine Verletzungen gingen. Ich lernte, zu fühlen, zu weinen, zu ruhen. Ich hörte auf, zu kämpfen. Ich begann, zu beten. Und ich spürte: Jesus liebt mich – nicht wegen meiner Leistung, sondern weil ich bin. Ich musste vieles loslassen: meine Karriere, meine Ehe, meine Lebenspläne. Aber ich gewann etwas Größeres: mich selbst. Und Stück für Stück lernte ich, dieses neue Leben anzunehmen. Es war radikal anders – langsamer, echter, zerbrechlicher. Aber es war wirklich meins.

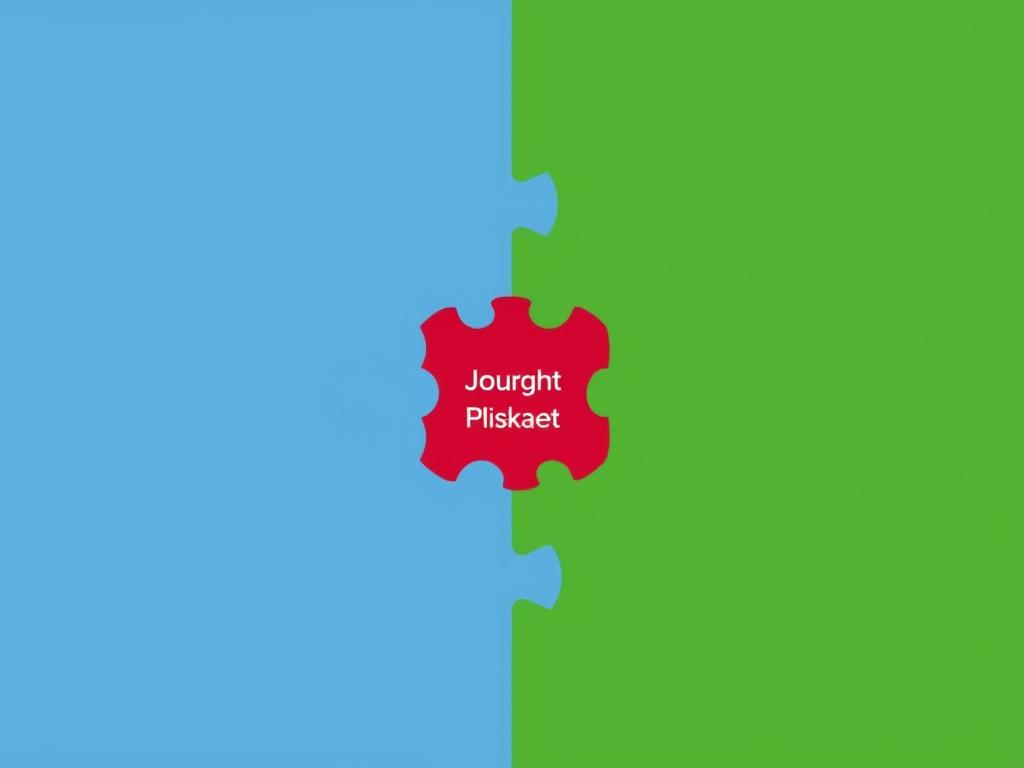
Der Weg zurück ins Leben
Ich lernte, einfache Dinge zu lieben: ein Spaziergang, Musik, ein gutes Gespräch, ein Lächeln. Ich lebte in einer therapeutischen WG, lernte Menschen kennen, die mich nicht für meine Leistung, sondern für mein Sein mochten. Ich fing an, mich selbst zu mögen – vorsichtig, tastend. Ich übte, „Nein“ zu sagen, Grenzen zu setzen, mich auszuruhen. Ich begann, meinem inneren Kind zuzuhören. Es wollte spielen, lachen, malen, singen. Und es wollte endlich weinen dürfen – über alles, was war. Ich ließ es zu. Und ich spürte: Das Leben kann schön sein. Nicht perfekt, nicht sicher, nicht spektakulär. Aber kostbar, lebendig, mein. Ich schrieb Tagebuch, hörte Lobpreismusik, sprach mit Jesus. Ich lernte: Ich bin geliebt. Ich bin genug.


Heilung geschieht langsam
Es gab Rückfälle, dunkle Tage, alte Muster. Ich zweifelte oft, hyperventilierte, weinte. Manchmal dachte ich: Ich schaffe das nicht. Aber dann kamen auch andere Tage: hell, leicht, friedlich. Ich merkte: Ich bin stärker, als ich dachte. Ich lernte, dass Heilung nicht bedeutet, nie mehr zu leiden – sondern, sich nicht mehr davon beherrschen zu lassen. Ich fand neue Worte, neue Wege. Ich lernte, mich selbst zu trösten. Ich entdeckte meine Berufung neu – nicht im klassischen Sinne, sondern im echten: für mich da zu sein, für andere, für das Leben. Ich begann, meine Geschichte zu erzählen. Nicht als Held, sondern als Mensch. Und darin liegt eine Kraft, die ich früher nicht kannte. Eine stille, heilige Kraft.


Ein neuer Blick auf meine Vergangenheit
Früher hasste ich meine Geschichte. Heute beginne ich, sie zu achten. Sie hat mich zerbrochen, ja – aber sie hat mich auch weich gemacht. Ich bin kein Held. Aber ich bin wahr. Ich habe überlebt – und ich beginne zu leben. Mein Vater, meine Mutter, meine Exfrau – ich trage noch Wunden. Aber ich gebe sie nicht mehr weiter. Ich unterbreche den Kreislauf. Ich schaue mein inneres Kind an und sage: „Ich bin jetzt bei dir.“ Ich spreche mit Jesus darüber – und spüre: Ich muss das nicht alleine tragen. Ich darf traurig sein. Ich darf auch wütend sein. Und ich darf endlich frei sein. Nicht, weil alles gut wurde. Sondern weil ich gelernt habe, mich selbst zu halten – mit allem, was ist.


Leben in Rente – Leben in Freiheit
Ich bekomme volle Erwerbsminderungsrente. Das fühlt sich seltsam an mit 42. Manchmal wie ein Scheitern. Aber oft auch wie ein Geschenk. Ich darf ruhen. Ich darf heilen. Ich muss nicht funktionieren. Das ist radikal neu – und manchmal beängstigend. Aber es gibt mir Luft zum Atmen. Ich beginne, mein Leben zu gestalten. Leicht, spielerisch, ohne Druck. Ich darf träumen: von Büchern, Vorträgen, Coaching. Nicht als „Muss“, sondern als „Darf“. Ich bin frei. Und in dieser Freiheit wachse ich neu. Langsam, echt, mit viel Pausen dazwischen. Ich lerne, das Leben zu genießen – mit gutem Essen, schönen Gesprächen, Musik, Gebet, Freundschaft. Ich bin nicht mehr nur überlebt – ich bin am Leben.


Was ich heute glaube
Ich glaube an Heilung. An Jesus. An den Weg zurück zum Herzen. Ich glaube, dass kein Mensch zu kaputt ist, um geliebt zu werden. Ich glaube, dass unsere tiefsten Wunden zu Quellen werden können – für Mitgefühl, Tiefe, Kraft. Ich glaube, dass ich nichts leisten muss, um wertvoll zu sein. Ich darf sein. Ich darf leben. Ich darf geliebt werden. Ich glaube, dass Gott mich nie verlassen hat. Und dass er auch dich nicht verlässt. Ich bin unterwegs – nicht am Ziel. Aber ich bin nicht mehr allein. Ich nehme mein inneres Kind an die Hand. Und ich gehe. Schritt für Schritt. Und wenn ich falle, stehe ich wieder auf. Weil ich weiß: Ich bin gehalten. Geliebt. Genug.

